Wo die Dinge enden
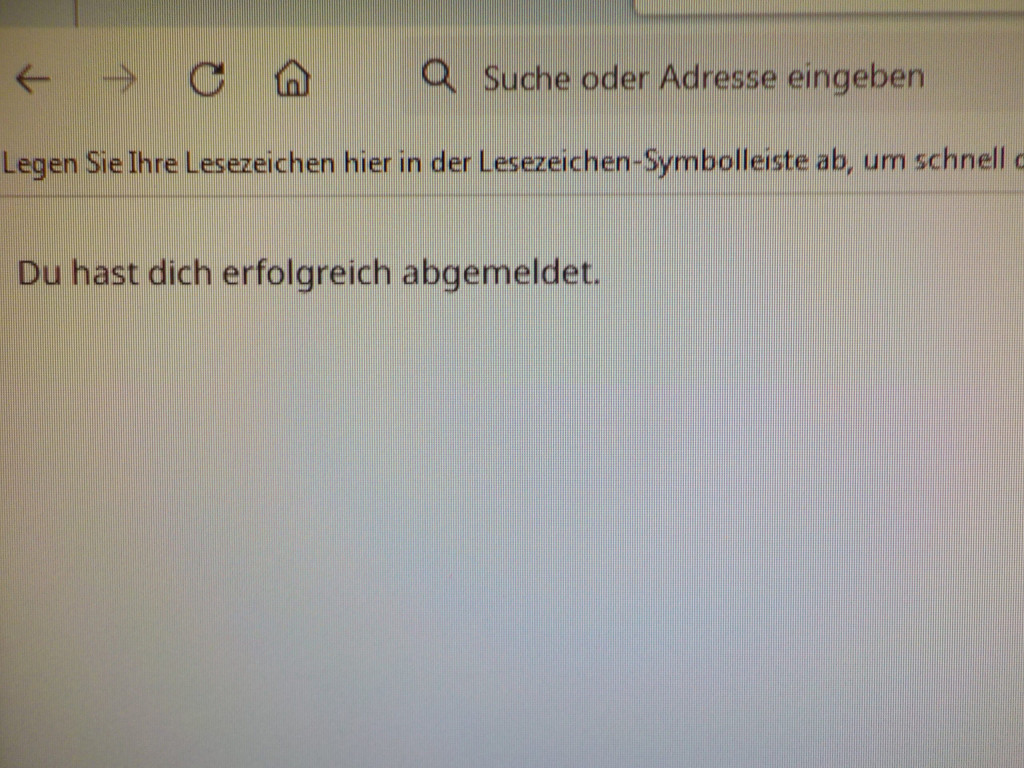
Mitunter kann es hart sein, sich für eine Lebensweise ethischer Mehrfachbeziehungen zu entscheiden. Insbesondere, wenn wir diese Lebensweise irgendwann für uns weitgehend verinnerlicht haben – und dann beginnen, unser übriges Leben dahingehend konsequent durchzuräumen:
Kein falsches Verstecken von Liebsten mehr vor der Familie an Tantchens Kaffeetafel, kein Schweigen mehr bei flauen Witzchen im Freundeskreis auf Kosten nicht-normativer Lebensweisen, keine Kompromisse bei Datingangeboten, die im zweiten Satz den Himmel auf Erden verheißen, falls…, ja, falls man sich doch schlicht auf bloß eine*n Lebenspartner*in festlegen würde.
Nein.
Irgendwann haben wir das alles hinter uns. Haben uns vor uns selbst lange genug für unsere Doppelmoral geschämt und für unsre lauwarmen Kompromisse „um des lieben Friedens willen“. Wir haben unsere Lebensphilosophie immer wieder in Kopf und Herz gewälzt und uns schließlich freigemacht, spätestens, als wir begriffen haben, wie sehr unsere Art und Weise intime Nahbeziehungen aufzufassen, mit unserem innersten Selbst zu tun hat.
Irgendwann beginnen wir zu akzeptieren, daß wir demzufolge (bislang) wohl zu einer Minderheit gehören und fangen an, uns damit zu arrangieren. Wir lassen uns dafür aber nicht mehr zurück in den Besenschrank treiben und tragen unser Haupt trotzdem erhoben.
Dafür schneiden wir nun manchen Arbeitskolleg*innen schon mal das Wort ab, wenn sie wieder darüber lästern, wer heutzutage alles mit wem zusammenleben darf und man dazu noch sein Geschlecht je nach Laune wählen dürfte – und so gelten wir nun manchmal als „seltsam“, „schwierig“ oder gar „unangenehm“.
Zu manchen Teilen unserer Geburtsfamilie fahren wir nicht mehr, weil wir uns nicht mehr ihrem wiederkehrenden Diktat unterwerfen, wie unsere Abweichung von einer „gescheiten bürgerlichen Beziehung“ doch sicher unserem Ansehen und einer künftigen Karriere schaden würden.
Und unser Freundeskreis wird kleiner, weil wir für einige dort mit unserem Bekenntnis zu Mehrfachbeziehungen nun nachgerade unanständig wirken – oder wenigstens wie eine tickende Hormonbombe, die aus bisher freundschaftlichen Banden vermutlich alsbald konkretes sexuelles Begehren hervorbrechen lassen könnte…
So setzt manchmal ein nachgerade eigentümlicher Effekt ein. Unser Coming-out hinaus in eine Welt ethischer Mehrfachbeziehungen wie Oligo- oder Polyamory führt dazu, daß wir statt – wie eventuell anzunehmen – mehr Beziehungen in unserem Leben haben, es durch diesen Schritt weniger werden: Das Telefon schweigt zunehmend, der Email-Eingang wird übersichtlicher, zunehmend seltener zirpt der Messaging-Dienst oder die Dating-App auf dem Mobilteil – und einige Einladungen zu den sonst so üblichen sozialen Stell-dich-eins lassen auffallend nach.
Ein etwas merkwürdiges Gefühl von Leere statt von Erfüllung und endlich-Angekommensein breitet sich aus…
„Sie haben sich erfolgreich abgemeldet.“ heißt es – und Du denkst: „Offensichtlich vollständiger, als ich geahnt hatte…“
Dies ist mein Novembereintrag, in diesem Monat, dem mit endzeitlichen Halloweengestalten, Allerheiligenkerzen auf Gräbern, Nebel und kahl werdenden Bäumen auf diese Weise oft ein deutlicher Hauch von Abschiednehmen umweht.
Darum möchte ich diesen Eintrag auch dem Abschiednehmen (und ein wenig der dazugehörigen Trauer) widmen, speziell dem Abschiednehmen von Beziehungen – was genau genommen ein Abschiednehmen von vertrauten Vorstellungen und liebgewonnenen Projektionen ist, wie ich gleich zu zeigen versuche.
Zu Beginn dieses Eintrags schrieb ich, daß eine Entscheidung für eine Lebensweise und Philosophie ethischer Mehrfachbeziehungen hart sein kann. Denn wenn wir nicht mit deren Werten von klein auf aufgewachsen und sozialisiert sind, begeben wir uns in der Tat dadurch zunächst einmal auf einen Weg vieler kleiner Abschiede. Und dabei ist es für unser innerliches Empfinden gleichgültig, ob wir uns von konkreten Personen trennen – oder von sonstigem gewohnten Terrain.
Denn ein Unterschied darin ist für unseren Geist gewissermaßen gar nicht vorhanden, ist dieser doch jedes Mal zunächst mit einem Frustrationserleben konfrontiert.
Bereits in meinem „Wüstenzeit“-Eintrag 22 steht ja, daß Frustration das „Erlebnis der (tatsächlichen oder vermeintlichen) Benachteiligung oder Versagung [ist], das sich als gefühlsmäßige Reaktion auf eine unerfüllte oder unerfüllbare Erwartung (Enttäuschung), z.B. infolge des Scheiterns eines persönlichen Plans oder der teilweise oder gänzlich ausbleibenden Befriedigung primärer und sekundärer Bedürfnisse einstellt. Frustration kann einerseits zu konstruktiver Verhaltensänderung führen, löst aber häufig regressive, aggressive oder depressive Verhaltensmuster aus.“
Intensiv mit Abschied und Verlust hat sich die amerikanische Psychologin Pauline Boss auseinandergesetzt. In der Fachpublikation „Family Relations“ ¹ schreibt sie, daß uns Menschen Abschiede und Trennungen, sei es in freundschaftlichen oder romantischen Beziehungen, oft wie ein „uneindeutiger Verlust“ erscheinen. Manchmal ist uns in unserer Frustration und unserem Schmerz also gar nicht klar, was genau wir eigentlich verloren haben.
Die Psychologin Eva Siem, welche die deutsche Meditations-App „7Mind“² mitgestaltet, schreibt auf der dazugehörigen Webseite:
»Häufig ist es nicht nur der Verlust einer Person, sondern auch der Verlust von Träumen, emotionaler Unterstützung und einer Identität, die eng mit dieser Person verbunden ist.
Zwischenmenschliche Beziehungen können nämlich eng mit unserem eigenen Selbstbild verknüpft sein. Zum Beispiel kann jemand in einer Freund:innenschaft die Rolle des oder der einfühlsamen Ratgebenden einnehmen. Wenn die Freund:innenschaft endet, kann der Verlust dieser Rolle zu einem Identitätskonflikt führen und die Frage aufwerfen: “Wer bin ich ohne diese Rolle?” Gemeinsame Träume und Pläne, wie eine Reise oder das Gründen einer Familie, können ebenfalls zerbrechen. Egal, ob wir verlassen oder verlassen werden – bei einer Trennung kann es sich anfühlen, als würde ein Teil von uns selbst verloren gehen.«
Wie sehr wir solche Verluste empfinden oder verarbeiten können, hängt mit einem Thema zusammen, welches ich in Eintrag 14 schon einmal ausgeführt habe – und welches in der gerade aktuellsten Buch-Publikation zum Thema Polyamory, nämlich dem Titel „Polysecure: Bindung, Trauma und konsensuelle Nicht-Monogamie“ von Jessica Fern (divana-Verlag 2023) noch einmal besonders betont wird: Unsere während unseres Aufwachsens erlernten Bindungsstile³.
Ich zitiere noch einmal aus dem 7Mind-Artikel wegen der kompakten Erklärung zu den verbreitetsten Formen „ängstlichem“ und „vermeidendem (abweisendem)“ Stil:
»Zum Beispiel sind Menschen mit einem ängstlichen Bindungsstil oft stark auf die Bestätigung und Nähe ihrer Partner:innen [oder ihrer übrigen Umgebung!] angewiesen und haben Angst vor dem Verlust der Beziehung(en), was das Loslassen erschwert. Womöglich bleiben sie lieber in einer unglücklichen Beziehung aus Angst davor, allein zu sein.
Ähnlich tun sich vermeidende Menschen häufig schwer damit, loszulassen, da sie gelernt haben, emotionale Distanz zu wahren und Intimität zu vermeiden. Für sie mag eine unerfüllte Beziehung besser erscheinen als die Verwundbarkeit und Angst vor Nähe in einer möglicherweise tieferen Verbindung.«
Wenn wir dann also irgendwann tatsächlich aus bestimmten Umständen oder Beziehungen heraustreten, ist es gar nicht so sehr unwahrscheinlich, daß wir zunächst einmal vielleicht ein schlechtes Gewissen, Reue oder sogar Einsamkeit und Angst empfinden.
Auch die 7Mind-App empfiehlt daher, sich die Zeit zu nehmen, sich noch einmal gut darüber klar zu werden, was tatsächlich verloren – aber auch gewonnen wurde:
Loslassen bedeute in vielen Fällen eben nicht nur einen Abschied von einem Abschnitt unserer Vergangenheit, sondern auch von einer vorgestellten Zukunft (die sich zumindest vielleicht hätte erfüllen können, wenn wir alles so belassen hätten, wie es war).
In ihrem Thesenpapier „Who am ‚I‘ without ‚you‘? – The Influence of Romantic Breakup on the Self-Concept (deutsch: Wer bin ‚ich‘ ohne ‚dich‘? – Der Einfluss der Auflösung einer romantischen Beziehung auf das Selbstkonzept)“ erklären die Forschenden Slotter, E. B., Gardner, W. L., u. Finkel, E. J. (2010), daß eine solche Veränderung gewissermaßen drei Phasen durchläuft, nämlich den Abschied von einem bisherigen Selbstkonzept („So glaube ich, daß ich bin“) – eine Trauerphase, die mit einer Entflechtung dieses Selbstbildes und daher auflösender Klarheit einhergeht, was zu emotionaler Belastung führt („Wer bin ich denn jetzt überhaupt noch?“) – und schließlich einer Anpassung mit Integration eines neuen Selbstkonzepts („Das bin ich jetzt“).
Für uns, die wir dementsprechend auf dem Weg in ethische Mehrfachbeziehungen also auch liebgewonnene/gewohnte Verbindungen oder auch bestimmte Menschen unserer Vergangenheit loslassen müssen, ist es daher wichtig, bewußt einen Teil von uns bisherigen Identität freizugeben, den wir aufrichtigerweise doch auch gar nicht mehr verwirklichen wollen.
Dazu kommt: Ein Verlust von Beziehung bedeutet ja vordergründig immer erst einmal ein stückweit Verlust von emotionaler oder vielleicht auch materieller Unterstützung.
Indem wir uns z.B. mit unserem Beziehungsleben zu einer Minderheit bekennen, bricht diese „Unterstützung“ vermutlich weg – weil wir uns nicht mehr einmütig zur kollegialen Lästerrunde einfinden, wir am Kaffeetisch nicht mehr nur mit einem ausgewählten Lieblingsmenschen erscheinen und „heile Familie“ spielen – oder weil wir für uns das Konzept „Freundschaft“ (und was darf dazugehören?) neu bewerten.
Die 7Mind-App nannte die daraus resultierende Frage oben „Wer bin ich ohne diese Rolle?“ – und das scheint mir die richtige Richtung zu weisen:
Denn wenn wir unser (Liebes)Leben in unserem Fühlen und Handeln zu einer Herangehensweise ethischer Mehrfachbeziehungen umgestalten, dann verlassen wir hoffentlich eine auch lediglich „angenommene Rolle“, bei der wir allerdings wahrscheinlich sehr lange unhinterfragt überzeugt waren, daß diese die einzig realisierbare wäre.
In unserer deutschen Sprache hängt das Wort „Rolle“ wunderbar mit dem Wort „entwickeln“ zusammen. Wir mögen uns also in einer angestammten „Rolle“ befinden – aber wir können und dürfen uns aus ihr ent-wickeln.
Auf vielen Seiten meines bLogs hier habe ich versucht darzulegen, daß es für mich eine bewußte und mutige Entscheidung ist, sich zu seinem eigenen, wahren Kern-Selbst hin zu entwickeln, wenn wir feststellen, daß wir in unserem Liebesempfinden die Kapazität für „mehr als zwei“ (oder genau genommen „mehr als eine*n“) entdecken.
Die Wissenschaftler*innen der in diesem Eintrag zitierten Beiträge unterstreichen, daß unsere zwischenmenschliche Beziehungen eng mit unserem eigenen Selbstbild verknüpft sind. Nähern wir uns mit unserem Selbstbild also immer mehr unserem Wesenskern, wird dies also auch stets konstruktiv die Art und Weise beeinflussen, welche Beziehungen wir eingehen – und wie wir diese führen möchten.
Sich für ethische Mehrfachbeziehungen zu entscheiden, wird darum höchstwahrscheinlich zudem erst einmal bedeuten, eine persönliche „Konsolidierungsphase“ zu durchlaufen. Konsolidierung heißt aber auch etwas zu festigen, zu stärken oder zu stabilisieren, um daraus etwas Geeigneteres, Verbindlicheres und Nachhaltigeres zu schaffen.
Für die Oligoamory habe ich immer betont, daß dabei aus meiner Sicht stets Qualität vor Quantität den Vorrang haben sollte. Nicht die Menge unserer potentiellen (Liebes)Verbindungen zählt, sondern deren Güte – mögen es auch wenige sein.
Verbindlich-nachhaltige (Mehrfach)Beziehungen zu führen kann so tatsächlich bedeuten, sich von dem ein oder anderen bisherigen Lebensumstand erfolgreich abzumelden, um dadurch mehr zu sich selbst zu gelangen.
Oder wie es die Psychologin Eva Siem vom 7Mind-Team schreibt – und um es nicht gar zu novemberlich werden zu lassen, wenn sich scheinbar bis zum wolkenverhangenen Horizont gerade keine weitere aufregende Beziehungsgelegenheit abzeichnet:
»Du bist nicht alleine mit der Herausforderung des Loslassens. Trauer und Veränderung sind ein wesentlicher Teil des Lebens, dem sich alle Menschen früher oder später stellen müssen.
Wie auch immer der Prozess für dich persönlich aussieht, betrachte ihn mit Wohlwollen und erinnere dich daran, dass das Loslassen auch eine Gelegenheit sein kann, dich selbst und deine Bedürfnisse besser kennenzulernen.«
¹ Boss, P. (2007). Ambiguous Loss Theory: Challenges for Scholars and Practitioners. Family Relations, 56(2), 105–110.
² Zur Hauptseite von 7Mind geht es HIER
Den Artikel von Eva Siem findet ihr HIER
³ Vor allem durch den britischen Psychoanalytiker und Kinderpsychiater John Bowlby und die Bindungstheorie; z.B.
Ainsworth, M. D. S., & Bowlby, J. (1991), An ethological approach to personality development. American Psychologist, 46, 331-341.

