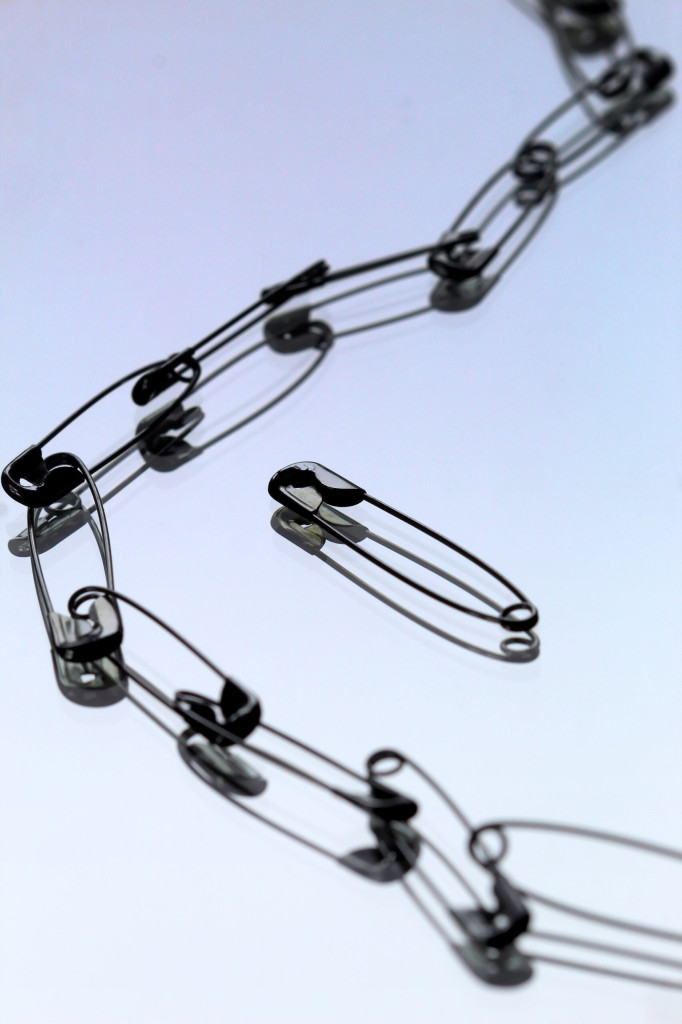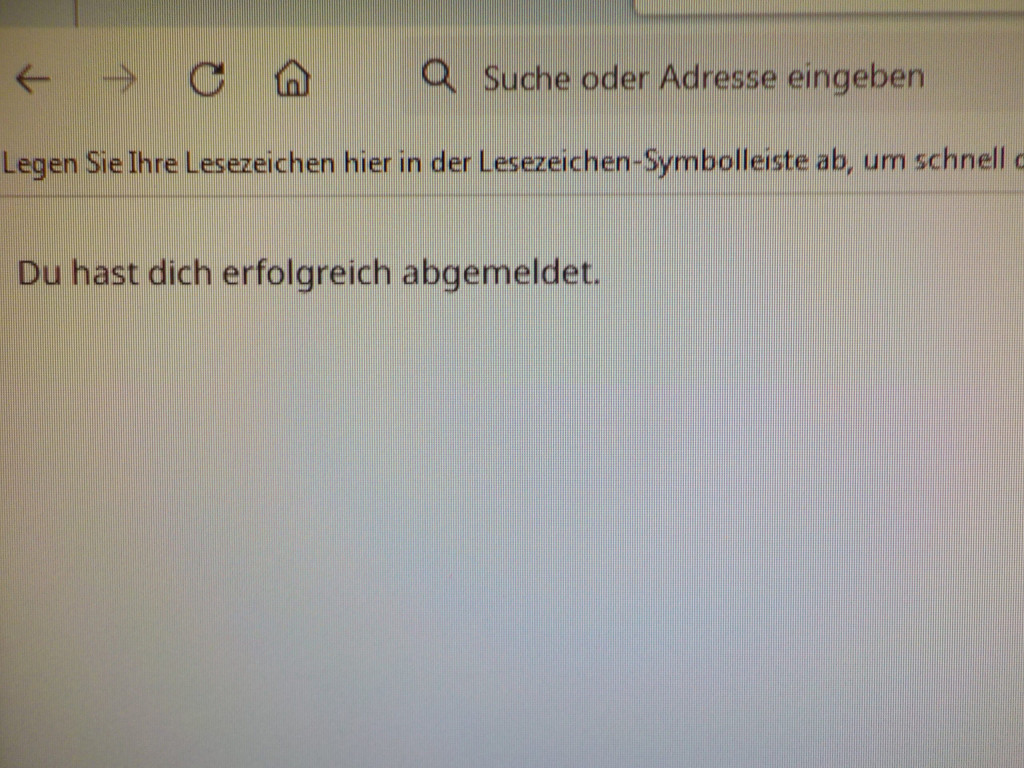Ressourcenkuchen

Festwochen auf dem Oligoamory-bLog – und ein Jubiläum folgt dem nächsten: Der 100. Eintrag ist heute zu bewundern! Hinter dem raschen Wechsel herausragender Wegmarken (letzten Monat erst haben wir 5 Jahre Oligoamory gefeiert) steckt diesmal allerdings vor allem rechnerische Finesse: Da ich im ersten Jahr meines Bloggens jeden Monat 4 Artikel verfaßt hatte, ergibt sich auf diese Weise der 100. Eintrag durch die Summe fleißiger 61 Monate, nachdem in Jahr Zwei mein Projekt zu einer Monatsschrift geworden war.
Für die schöne runde Zahl gibt es natürlich trotzdem Kerzen und Kuchen – und Letzterer ist quasi Sinnbild für mein heutiges Thema, welches in der Welt ethischer Mehrfachbeziehung immer wieder einen wichtige Rolle spielt: Ressourcen.
Eine Ressource, so sagt die deutschsprachige Wikipedia, ist „ist [ein] Mittel, [eine] Gegebenheit wie auch [ein] Merkmal bzw. [eine] Eigenschaft, um Ziele zu verfolgen, Anforderungen zu bewältigen, spezifische Handlungen zu tätigen oder einen Vorgang zielgerecht ablaufen zu lassen.“ Der Wikipedia-Eintrag ergänzt ferner: „Eine Ressource kann ein materielles oder immaterielles Gut sein, […] in der Psychologie auch Fähigkeiten, persönliche Eigenschaften oder eine geistige Haltung, in der Soziologie auch Bildung, Gesundheit, Prestige und soziale Vernetzung. In psychologischen und psychosozialen Handlungsfeldern werden häufig auch die Begriffe „Stärken“ oder „Kraftquellen“ benutzt.“
Drei Sätze aus einer Online-Enzyklopädie und schon wird deutlich, daß niemand, die*der sich in eine Struktur mehrerer romantischer Partnerschaften – und eben womöglich mit mehreren real existierenden Partner*innen – einbringt, um dieses Thema herumkommt.
Denn für dann wirklich im grünen Leben wurzelnde, tatsächlich praktikable Mehr-Personen-Netzwerke sind die persönlichen Ressourcen eine entscheidende – wie sagt man heute neudeutsch? – „Benchmark“ (in etwa: Vergleichsmaßstab), exakt was ihre Realisierbarkeit, ihr Zustandekommen und ihre Fortführbarkeit angeht.
Warum dies so wichtig ist, skizzierte ich bereits im ersten Jahr dieses Projekts hier in meinem „Dating“-Eintrag 30, indem ich fragte: „Habe ich derzeit die Kapazität in meinem Leben, einen (weiteren) GANZEN Menschen als solchen zu würdigen?“
Diese Frage stellt sich selbstverstänlich bei der Aufnahme jedweder Form von romantischer Beziehung – wenn es allerdings um ein Leben mit noch mehr als nur eine*r*m weiteren „Beziehungsteilnehmer*in“ geht, kann sich die Herausforderung der Ressourcenbereitstellung und -zuwendung entsprechend potenzieren (zumindest erscheint es manchmal so…).
Womit wir auch bei unserem heutigen Titelfoto mit dem (Jubiläums-)Kuchen als Ressourcensinnbild angekommen wären. Welches ich hübsch passend finde, denn natürlich ist so ein Kuchen normalerweise da, um hoffentlich mit anderen geteilt zu werden.
Zugleich… – wie er da so liegt, vorgeschnitten in seiner Kunststoffschale – scheint auch diese Ressource ihrerseits genau genommen Teil von etwas Größerem zu sein. Das ist wunderbar: Sage ich über ethische oligoamore Mehrfachbeziehungen doch nahezu seit der ersten Stunde (und so steht es auch auf meiner Startseite), daß es bei ihnen um ein Erleben geht, welches „größer ist als die Summe ihrer Teile“…
Die Jetztzeit mit Klimawandel und ökologischem Umdenken zeigt uns aber auch, daß Ressourcen eben nicht unendlich sind. Dies gilt auch für unsere persönlichen Ressourcen in Beziehungen. Nicht zufällig ist der Untertitel des Oligoamory-Projekts „verbindlich-nachhaltige Beziehungen“ (und über den „Nachhaltigkeits-Teil“ spreche ich bereits im letzten Abschnitt von Eintrag 3).
Begrenzte Ressourcen führen dazu, daß mit ihnen aufmerksam gehaushaltet werden sollte, was jedoch manchmal zu Aufteilung und Rationierung führt: Was, wer wann, wovon, wieviel erhält – und schon hat man statt üppiger Torte ein rein funktionales Tortendiagramm vor Augen, mit seinen farbigen größeren und kleineren Segmenten…
Diese Tendenz macht auch vor Mehrfachbeziehungen nicht halt – denn Teilhabe an einem Kuchen, zu dem alle beitragen, ist ja nur die eine Seite der Medaille. Die andere Seite beschreibt der britische Entschleunigungs-Autor Matt Haig folgendermaßen:
»Obwohl es heißt, dass der Dichter Samuel Taylor Coleridge der letzte Mensch war, der alles gelesen hat, ist dies technisch unmöglich, da er 1834 starb, als es bereits Millionen von Büchern gab. Interessant ist jedoch, dass die Menschen der damaligen Zeit glauben konnten, dass es möglich war, alles zu lesen. Heute könnte das niemand mehr glauben.
Wir alle wissen, dass, selbst wenn wir den Weltrekord im Schnelllesen brechen, die Anzahl der von uns gelesenen Bücher nur einen winzigen Bruchteil der existierenden Bücher ausmachen wird. Wir ertrinken in Büchern, so wie wir in Fernsehsendungen ertrinken. Und doch können wir immer nur ein Buch lesen – und nur eine Fernsehsendung zur gleichen Zeit sehen. Wir haben alles vervielfacht, aber wir selbst sind immer noch individuelle Einzelwesen. Es gibt uns nur einmal. Und wir sind alle kleiner als das Internet. Um das Leben zu genießen, sollten wir vielleicht aufhören, darüber nachzudenken, was wir niemals lesen und sehen und sagen und tun werden, und anfangen, darüber nachzudenken, wie wir die Welt innerhalb unserer Grenzen genießen können. Nach einem menschlichen Maßstab zu leben. Wir sollten uns auf die wenigen Dinge konzentrieren, die wir tun können, und nicht auf die Millionen von Dingen, die wir nicht tun können. Uns nicht nach parallelen Leben sehnen. Eine angemessenere Form der Mathematik finden: Eine stolze und einzigartige Eins zu sein. Eine unteilbare Primzahl.«¹
Hoffen wir also, daß wir unsere Mehrfachbeziehungen nicht aus dem Vervielfältigunsreflex heraus gewählt haben, nur ja nichts zu verpassen. Die Versuchung, auch mehrere Beziehungen als „parallele Leben“ zu führen, ist jedenfalls in der Polyamory sehr real (meine Sorge darum bereits Eintrag 2!). Selbstfürsorge ist hingegen angeraten, wenn Mehrfachbeziehungen in Hinblick auf unsere Ressourcen „nachhaltig“ geraten sollen.
Grundsätzlich würde ich dabei meiner Erfahrung nach zwischen „äußeren“ (z.B. Geld/Einkommen, Transportmittel, Wohnraum, Infrastruktur, Zugang zu Unterstützung, Rechtsstaalichkeit etc.) und „inneren“ Ressourcen (u.a. Resilienz, Empathie, Offenheit, Beziehungsfähigkeit, Konflikt- oder Kritikfähigkeit usw.) unterscheiden – wiewohl es da Überschneidungen gibt:
Ein typisches Phänomen für Überschneidungen ist bereits der Zeitpunkt – unübertroffen aus dem Englischen mit dem Begriff „Timing“ versehen – beispielsweise: Muss ich mich momentan um die Heimeinweisung meiner Mutter kümmern, die letzte Woche ihre Demenzdiagnose erhalten hat? Oder bin ich gerade im dritten Trimester schwanger?
Versteht mich richtig: Wenn die Liebe in unseren Leben Einzug hält, dann fragt diese oft nicht unbedingt danach, ob es gerade günstig ist. Aber manchmal gibt es schwerwiegende äußere Umstände und Prozesse, die uns schon rein faktisch – aber eben auch mental sowie psyschisch – so sehr mit Beschlag belegen, daß wir möglicherweise gerade nicht die beste Variante unseres Selbst sind – auch hinsichtlich unserer Fähigkeit, mit noch zusätzlichen, wegweisenden Entscheidungen über den aktuellen Stress hinaus konfrontiert zu sein (weitere typische „Überschneidungsressourcen“ sind daher z.B. auch Gesundheit, Integration/Teilhabe, sowie sozial Einbettung u. persönliche Kontakte insgesamt).
Überhaupt die wichtige „Ressource Zeit“ – scheinbar ein mathematischer äußerer Faktor, der unsere Lebenszeit buchstäblich in die Tortendiagramm-Segmente des Zifferblatts presst: Zeit für Essen, Schlafen und die Verbindlichkeiten, die wir eingegangen sind, z.B. häufig Arbeit – aber eben auch andere Engagements und Beziehungen vielfältiger Natur, denen wir gerecht werden wollen. Wir beginnen folglich mit dem Einteilen – und Aufteilen – und der organisatorische Aufwand der damit einhergeht, wächst proportional mit der Verknappung, die wir selbst mit vorantreiben.
Der Autor Matt Haig hat aber recht, wenn er verdeutlicht, daß eben – wie es die Redewendung über die Liebe verspricht – durchaus nicht alles stets „mehr wird, wenn man es teilt“. Denn am Ende aller Vervielfältigung, Multiplikation und jedwedem „mehr“ bleiben wir selbst – mit unseren Sinnen und Empfindungen, die uns das Erleben ermöglichen – un-teilbar (siehe letztes Drittel Eintrag 98: In-dividuum).
Und gerade weil dies so ist, besteht die Gefahr, daß wir beginnen, unsere Lebenszeit – auch und speziell was unsere Beziehungen angeht! – immer dünner zu verstreichen, bis wir uns so vorkommen, wie es der Fantasy-Autor J.R.R. Tolkien den armen geplagten Bilbo im „Herrn der Ringe“ (Bd.1 „Die Gefährten“) sagen läßt: „Ich fühle mich dünn, irgendwie gestreckt, wie Butter, die auf zuviel Brot verstrichen wurde.“
Von Torte und Genuß ist da längst nichts mehr übrig. Von nachhaltig ganz zu schweigen…
Was unsere Ressourcen angeht, können wir uns aber noch durch zwei weitere Faktoren zu Fehlschlüssen verleiten lassen, die wiederum eher dazu führen werden, daß wir uns sprichwörtlich „zuviel auf den Teller laden“ – und dann aus einem eventuellen (Vor)Sorgekarussell gar nicht mehr beizeiten aussteigen können.
Zum einen ist dies in der ungünstigen biographischen Lernerfahrung begründet, die ich bereits in Eintrag 27 und Eintrag 98 mit den Worten Friedrich Schillers „Der Starke ist am mächtigsten allein“ benannte.
Solch ein manifestierter Glaubenssatz entsteht meist durch negative (Lebens)erfahrung, daß man sich auf andere nicht verlassen kann, woraus häufig die Einstellung resultiert, daß „…wenn du etwas getan haben willst, du es lieber selbst tun solltest…“
Zum anderen kann dies geschehen, wenn wir es mit dem schönen oligoamoren Prinzip „die anderen (Beteiligten) mit-hineindenken“ aus Eintrag 53 übertreiben und versuchen, die Hoheitshemisphäre der anderen Beziehungsteilnehmer*innen in einer gewissen Form vorauseilenden Bedenkens mitzumanagen.
Diesen Teil schreibe ich, weil es etwas ist, bei dem ich mich selbst doch immer wieder ertappe – genau weil ich vergessen, daß es sich bei den anderen Beziehungsbeteiligten doch wahrhaftig ebenfalls um GANZE, kompetente Personen handelt.
Dann überrasche ich mich dabei, wie ich hinsichtlich Verabredungen bereits mit km-Abständen und Navigationsanwendungen jongliere, wenn ich mit Mahlzeitenplänen hantiere oder die Fürs und Wieders ganzer Wochenendplanungen mit den mir bekannten Vorlieben und Abneigungen der Teilnehmenden abgleiche…
Und bevor ich so ein Koordinations-Ungeheuer auch nur annähernd erfolgreich erlegt hätte, erreicht mich manchmal zur Rettung dann eine E-Mail irgendeines Lieblingsmenschens, der mir schreibt, wie sie*er die (für mich erschreckend lästigen) km problemlos zu mir kommt; was sie*er zu essen mitbringt und daß wir doch gar nicht soviele Aktionspunkte bräuchten, weil unser gemeinames Zusammentreffen schließlich die wichtigste Priorität sei. Punkt.
Manchmal aber auch nicht – und ich verheddere mich gänzlich unnötig in einem Gewirr gut gemeinten, vorauseilenden Gehorsams, abgeschmeckt mit ein paar unterschwelligen Bevormundungen aufgrund meinerseits unterbliebenen Nachfragens…
Solch ein ungünstiges „Katz-und-Maus-Spiel mit sich selbst“ kann man übrigens richtig auf die Spitze treiben. Denn natürlich ist es gut und richtig, sich über seine Ressourcen klar zu werden – und über das, was an Kapazitäten für (weitere) eigene Beziehungen (noch) zur Verfügung steht. Sich allerdings zu fragen, was man denn einer anderen Person überhaupt zu bieten hätte, wo man doch schon ein so volles Leben hat, ist ein vor allem selbstzerfleischendes aber letzlich recht substanzloses Unterfangen – da es doch die Augen und Herzen der anderen sind, die hoffentlich uns ihrereseits aus ganz eigenen – und spezifisch guten Gründen wählen.
Womit ich sagen will: In Beziehung zu SEIN kann uns leider immer noch gelegentlich vegessen lassen, daß wir darin nicht die Last des Universum nur auf unseren Schultern tragen müssen. Oder daß bloß unsere Schultern die besten wären, auf denen es ruht…
Eine wichtige Ressource ist nämlich auch, die Grenzen der eigenen Beherrschbarkeitssphäre zu würdigen.
Zum einen, daß wir uns nämlich endlich davon befreien dürfen, indem wir ja gerade NICHT allein sind, in allem immerfort stark sein zu müssen.
Denn zum anderen sind die übrigen (Beziehungs)Beteiligten doch ganz und gar großartige, fähige – ja eben – GANZE Menschenkinder, mit gänzlich eigenen Ideen, Talenten und Ressourcen, die Gebiete und Reserven betreffen können, welche vermutlich durchaus anders als die unsrigen gegründet sind.
Ideen, Talente und Ressourcen also, die uns wiederum das außergewöhnliche und wohltuende Erleben davon ermöglichen, doch aus etwas Größerem zu schöpfen als der bloßen Summe der Teile…
Natürlich bleibt es in ethischen (Mehrfach)Beziehungen richtig und wichtig, bei dem, was die Auswirkungen eigenen Planens und Handelns auf anderen Beteiligten angeht, diese „mit-hineinzudenken“. Egoistisch verwaltete Ressourcen, die nach eigenem Gutdünken vor allem unter Maßgabe größtmöglichen Eigennutzens zugewiesen werden, machen uns beziehungsunfähig und wenig liebenswert.
In Übereinstimmung mit den Worten von Matt Haig oben hat diesbezüglich z.B. der deutsche Sozialpädagoge und Konfliktforscher Klaus Wolf schon zu Beginn dieses Jahrtausends herausgearbeitet, daß eben auch individuelle selbstfürsorgliche Bewältigungsstile wie Optimismus bzw. Hingabe (im Sinne von: Zuwenden, Sich-öffnen, Empfangen) zu den essenziellsten persönlichen Ressourcen zählen.²
Und genau darum erlaubt uns das Anteilhaben an intimen Nahbeziehungen ebenfalls, bezüglich unserer Ressourcen gerade dort diese einzigartige Stimmung zu erfahren, die für mich am eindrücklichsten der empfindungsreiche österreischische Lyriker Rainer Maria Rilke in Worte fasste³:
Rast!
Gast sein einmal.
Nicht immer selbst seine Wünsche bewirten
mit kärglicher Kost.
Nicht immer feindlich nach allem fassen;
einmal sich alles geschehen lassen und wissen:
was geschieht, ist gut.
¹ Matt Haig: „Mach mal halblang. Anmerkungen zu unserem nervösen Planeten“, dtv Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG; 4. Edition (22. März 2019)
² Klaus Wolf: Sozialpädagogische Interventionen. In: Karin Lauermann, Gerald Knapp (Hrsg.): Sozialpädagogik in Österreich. Perspektiven in Theorie und Praxis. Band 3. Verlag Hermagoras/Mohorjeva, Wien, S. 92–105, hier S. 95; 2003
³ Auszug aus: Rainer Maria Rilke – „Die Weise von Liebe und Tod des Cornets Christoph Rilke“, geschrieben 1899, erste Veröffentlichung in der Insel-Bücherei 1912
Danke an MatissDzelve auf Pixabay für das Foto!