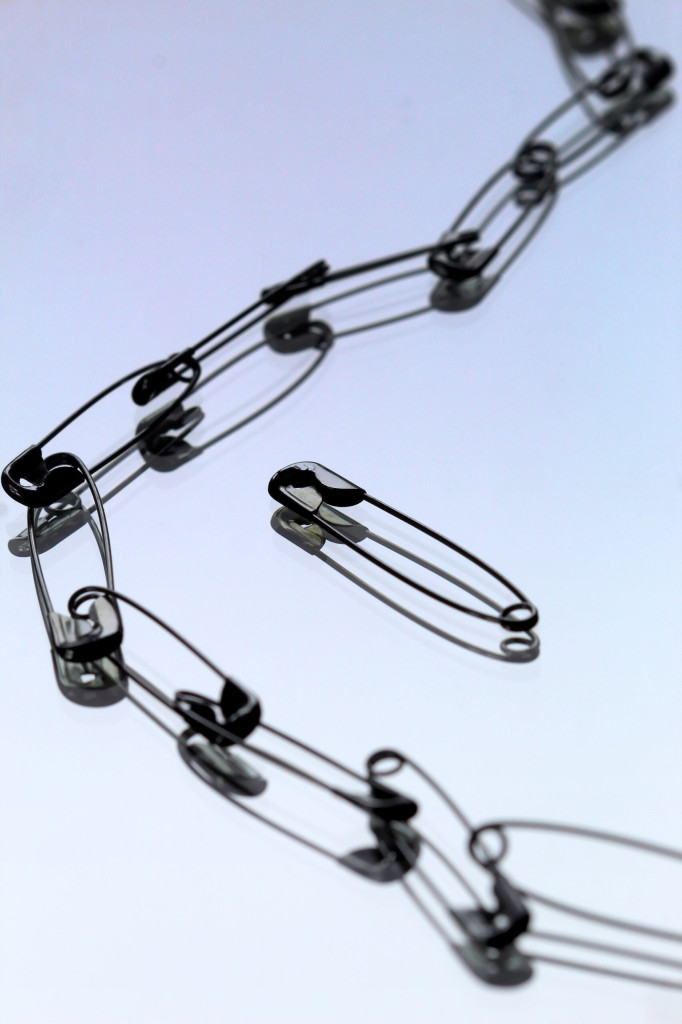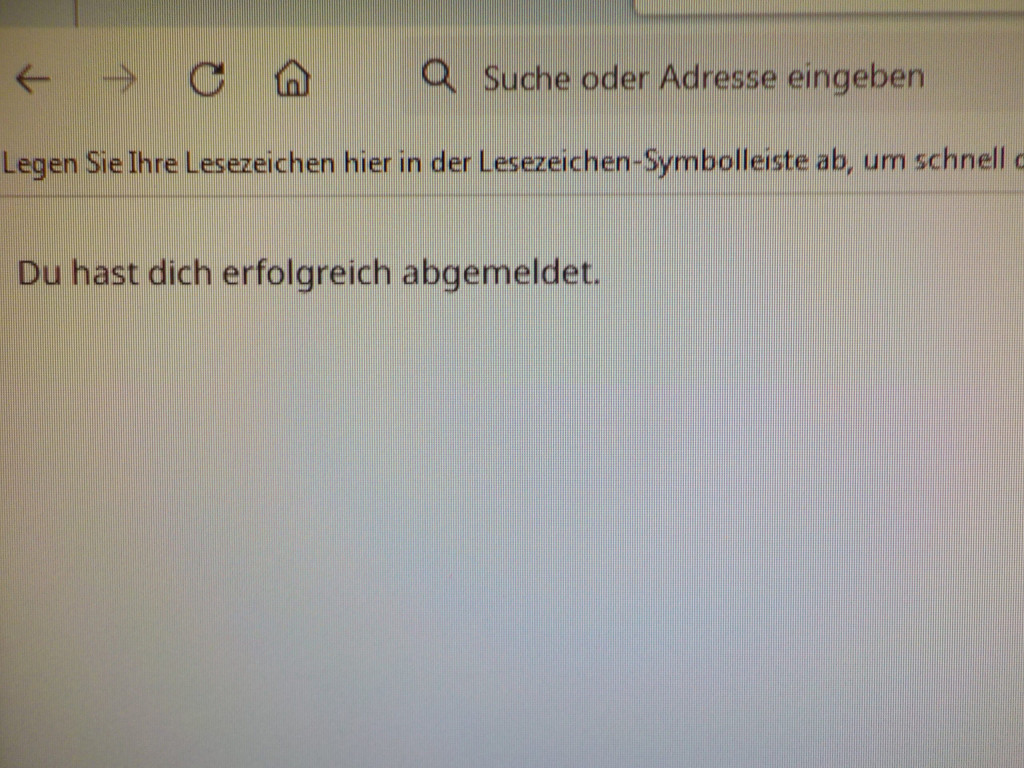Kopf und Fuß – oder: Der Blinde und der Lahme

Neulich hat mich eine Bekannte gefragt, wie denn meine bLog-Einträge normalerweise zustande kämen. Und ich sagte „Ganz verschieden – es kann manchmal sogar nur ein Wort sein, das mir im Gedächtnis bleibt, – und daraus entsteht ein vollständiger Eintrag.“
So ist es z.B. heute mit dem Wort „Abhängigkeitssymbiose“, welches ich vor einiger Zeit in einem gänzlich anderen Kontext als dem Universum der Mehrfachbeziehungen aufgeschnappt hatte.
Dieses Wort hat mich nämlich erst einmal irritiert, weil es für mich wirkte, als ob es aus zwei sehr unterschiedlichen Häften bestand, die gar nicht zueinander zu passen – ja, einander geradewegs zu widersprechen – schienen.
Und dann, als ich das Ganze einmal in meinem Kopf und dann in meinem Herzen herumbewegt hatte, habe ich gelächelt, denn mit einem Mal empfand ich den Begriff fast als ein bißchen hübsch in seiner Symbolik – und in diese Fall insbesondere für das Universum der Mehrfachbeziehungen.
„Abhängigkeit“, so sagt Wiktionary, steht für einen „Zustand, auf jemand oder etwas angewiesen zu sein“. Und damit hat das arme Wörtchen „Abhängigkeit“ auch meist sogleich seinen Charme weitestgehend eingebüßt. Denn uns in „Abhängigkeit“ zu befinden, auf jemanden oder etwas angewiesen zu sein, das klingt irgendwie klebrig, verhaftet, unselbständig und gebunden. Wodurch „Abhängigkeit“ nämlich unmittelbar in Verdacht gerät, das Antonym (= das Gegensatzwort) bzw. in gewisser Weise sogar der Antagonist (=Gegenspieler) unserer allseits beliebten und ersehnten „Freiheit“ zu sein.
Und dann ist da noch das Wort „Symbiose“. Hier definiert Wiktionary: „(das) Zusammenleben von Organismen verschiedener Arten zu gegenseitigem Vorteil“ bzw. „das Zusammenwirken von mehreren Faktoren, die sich vielfach gegenseitig begünstigen“. Womit Symbiose also wohl etwas Gutes und für die daran Beteiligten Lohnenswertes ist.
Damit wird aber zugleich klar, daß die in unserem urspünglichen Wortpaar zunächst als negativ wahrgenommene Abhängigkeit und die so vielversprechende Symbiose gar nicht wirklich gegensätzlich sind. Denn um von den Vorteilen einer Symbiose zu profitieren, müssten sich die Mitwirkenden wohl auf dieses „Aufeinander Angewiesensein“ einlassen, damit überhaupt eine solche zustandekäme…
Denn dies ist ja gerade das innewohnende Erfolgsgeheimnis jedweder Symbiose: Damit sie funktioniert – und „funktionieren“ heißt in diesem Fall: alle Beteiligten erfahren (Zu)Gewinn – müssen jene Beteiligte, wie ich im letzten Eintrag schrieb, „aus eigener Veranlassung nehmen UND geben“.
Dieser heutige Eintrag soll ein klein wenig ein „Erinnermich“ für ethische Mehrfachbeziehungen sein. Denn die Gefahr, daß wir in unseren Beziehungen zu stark bilanzieren – und das obendrein von einem zu selbstbezogenen Standpunkt – scheint mir nach wie vor sehr hoch.
Vor allem in einer Welt, wo wir regelmäßig u.a. mit Memen in sozialen Medien zugepfaster werden, die da mit Kalligraphiebuchstaben vor irgendeinem romantischem Fotohintergrund „Wahre Liebe gibt frei!“ postulieren.
Und nun komme ich und schreibe statt dessen viel lieber „Wahre Liebe… …ist symbiotisch!“ – und kann quasi hören, wie sich bei diesem Satz einigen Leser*innen knisternd die Haarspitzen aufstellen.
Gut, daß „Abhängigkeit“ in Beziehungsdingen für mich nicht grundsätzlich eine schlimme Sache ist, dürften regelmäßigere Konsument*innen meines bLogs spätestens seit meiner „Abhängigkeitserklärung“ in Eintrag 24 wissen. Dort schrieb ich – gewissermaßen als Fazit – daß »„Wechselseitige Abhängigkeit “ per se nach oligoamoren Maßstäben erst einmal kein behandlungsbedürftiger Makel sei, den es zu tilgen gelte, und sie in ihrer bewußten Form weder toxisch noch pathologisch sei.
Solch eine gut eingestellte – noch besser gut eingespielte – wechselseitige Aufeinanderbezogenheit stelle vielmehr ein engagiertes, dynamisches und offenes Binnenverhältnis dar, welches von regelmäßigen, gemeinschaftlichen Verhandlungen und (Nach)Justierungen profitiere.«
Für mich ist es aber trotzdem auch noch etwas mehr als das. Denn in der Oligo- und Polyamorie dreht sich nach meinem Empfinden am Ende des Tages alles um nichts weniger als wahrhaftige, romantische Liebe zwischen den so verbundenen Leutchen. Und wie ich wiederum in Eintrag 34 beschrieb, ist aufgrund meiner bisherigen Lebenserfahrung »der Kern des „romantischen Narrativs“ das freiwillig für die Gemeinschaft erbrachte Selbstopfer«.
Speziell letzterer Satz kommt beim Lesen immer erst einmal so unglaublich dramatisch daher, warum ich auch im zugehörige Eintrag damals gleich dieser Dynamik die (Hoch)Spannung nehme.
Symbiose, wenn sie romantisch (und nicht nur einen Zweckbeziehung) sein soll, benötigt aber darum ebenfalls genau dieses Selbstopfer.
Und vermutlich ist es daher auch geradewegs so ein unbehagliches Zwicken, was wir beim Begriff „Selbstopfer“ irgendwie empfinden, weil es dazu eben ohne die oben erwähnte „Abhängigkeit“ und damit einer Teil-Abgabe unserer vollen „Un-Abhängigkeit“, unserer größtmöglichen Freiheit, nicht geht.
Das ist auch ein Grund, warum ich Eintrag 102, in welchem ich exakt diese Freiheit feiere, die es uns überhaupt erst erlaubt, hinsichtlich unserem Wunsch nach Teilhabe und Verantwortungsübernahme Wahlen zu treffen, diesem Eintrag hier vorangestellt habe.
Denn es muß doch ein Ausdruck unseres nach Entfaltung suchenden Wesenskerns sein, wenn wir in uns den Wunsch finden, an einer „Symbiose“ (ich wiederhole: „das Zusammenleben von Organismen verschiedener Arten zu gegenseitigem Vorteil“) teilhaben zu wollen und damit zugleich bereitwillig die Verantwortung für den eigenen Beitrag am Gedeih dieses Gebildes mit zu übernehmen.
Wir haben es in Beziehungen also im ersten Moment stets mit einer freiwilligen Selbstbeschränkung zu tun – ein überaus romantisches Motiv übrigens. Z.B. so aufopferungsvoll-romantisch wie es einige Herren mit gesteiften Kragen im Jahr 1863 betrieben, als sie sich gegenüber einem wilden Gerangel um einen Lederball auferlegten, diesen künftig nur noch fair und gentlemenlike mit Kopf und Fuß zu bewegen – und auf diese Weise zu Gründern des modernen Fußballs avancierten…
Kurz vor dem Finale der derzeit stattfindenen EM finde ich hier Fußball übrigens eine durchaus treffende Metapher. Denn was wollten diese Leute damals erreichen, als sie sich selbst freiwillig beschränkten – und ein „weniger“ in Kauf nahmen?
Sie wollten einen „Mehrwert“ für alle erzeugen – weil sie der Meinung waren, daß mit roher Kraft und ganzem Körpereinsatz irgendwann irgendjemand so oder so in der Lage sei, einen Ball ins Tor zu bringen (was früher oder später nicht mehr sehr interessant gewesen wäre, es sei den für Leute, die den aufgepumptesten und rücksichtslosesten Protagonisten hätten bei ihrem Werk zuschauen wollen…).
Aus ihrer Selbstbeschränkung ging nun jedoch ein dynamisches, spannendes und integratives Spiel hervor, bei dem bis in die heutige Zeit Menschen aller Ethnien und Gender mit ihren vielfältigen Begabungen in Ausdauer, Geschick, Agilität, Mut, Findigkeit und Glück international um Aufmerksamkeit und Preise wettstreiten.
Die Vorteile von Wechselseitigkeit und Aufeinanderbezogenheit wie in einer Symbiose fallen uns also nach einer Weile also vielleicht doch noch ein – selbst wenn uns dabei aufgeht, daß wir dazu logischeweise eben (freiwillig!) einen Teil unserer persönlichen Freiheit dorthinein auflösen müssen, wenn wir wirklich mitwirken und profitieren wollen.
In den allermeisten Fällen handelt es sich dabei ja auch meist um das „Schönwettergesicht“ der Liebe, über die ich im vorherigen Eintrag schrieb: »Hand aufs Herz: Wenn es in den von uns eingegangenen Beziehungen nicht etwas gäbe, was wir – wie oben erwähnt – „genießen“ wollten, wären wir doch vermutlich nicht darin…«
Das ist dann wieder wie beim Fußball: Klar, mit den heutigen Regeln (denen ich zugestimmt und mich selbstbeschränkt habe) kann ich den Typen in Ballbesitz da vorne jetzt nicht niederschlagen, um an das Leder zu gelangen. Ich muß mich heranpirschen und das Ding vom Fuß dribbeln, wonach ich es mit einem Paß zu den Mitspieler*innen oder (hoffentlich) zum Tor schießen kann. Aber: Am Ende des Tages bin ich dann eben nicht ein dumpfer Schläger, der vielleicht sogar für den eigenen Erfolg Fremdschaden in Kauf genommen hat – ich bin ein*e begehrte*r Ballkünstler*in in einem erfolgreichen Team.
Und weil es gerade nicht nach den Stärksten oder Durchsetzungsfähigsten auf dem Platz geht – denn so funktionieren Symbiosen nicht – bin ich es vielleicht ohnehin nächstes Mal, die den Ball zum Schuß auf das Tor zugespielt bekommt – weil ich eben am günstigsten dazu in Position bin.
Ok – in meinen Beziehungen kann ich durch Beitragen profitieren. Und durch romantische Selbstzurücknahme Mehrwert erfahren, den ich sonst alleine nie hätte erleben oder erzeugen können.
Aber wie ist das mit dieser konkludent (= Handlung, die auf eine bestimmte Willenserklärung schließen lässt, ohne dass diese Erklärung in der Handlung ausdrücklich erfolgt ist [also z.B. die Einwilligung in eine Liebesbeziehung]) eingegangenen Verantwortung für den Gedeih und die Aufrechterhaltung eines solchen Zusammenlebens und -liebens?
Warum schrieb ich im vorigen Eintrag »Wenn wir es mit unserem Wunsch nach Anteilhaben an einer (Liebes)Beziehung jedoch ernst meinen, dann ist auch die Verantwortung im gleichen Augenblick mit eingezogen – die Selbstverantwortung und auch die Verantwortung für das Wohlergehen, den „Gesundheitszustand“ der Beziehung.«?
Selbst der Wikipedia-Eintrag zur „Symbiose“ zeigt doch unterschiedliche Grade der wechselseitigen Abhängigkeit auf und schlägt sogar vor „Die Arten ziehen zwar einen Vorteil aus dem Zusammenleben, sind aber ohne einander gleichwohl lebensfähig.“ Wäre das nicht auch eine Möglichkeit, menschliche, romantische Nahbeziehungen mit mehreren Beteiligten zu handhaben?
Ich glaube, daß sich solche Gedanken vor allem immer dann einschleichen, wenn wir realisieren, daß weder die Liebe noch wir ganz persönlich stets immer nur auf der Seite des oben erwähnten „Schönwettergesichts“ des Beitragens und Genießens zu agieren in der Lage sind.
Dazu sagte der buddhistische Shaolin-Meister Shi Heng Yi neulich in seiner Reihe „positivegedanken“ auf Instagramm etwas sehr Anrührendes, was sogar an Teile des christlichen Eheversprechens erinnerte:
»Und Loyalität bedeutet aber, daß man weiß, dass es Momente geben wird, wo wir uns eventuell uneinig sind.
Aber genau weil ich eben weiß, dass das eventuell eine schwierige Zeit für eine Person werden wird, weil jetzt sehr viel Kritik und sehr viel Schmach – oder egal was – kommen wird, genau deswegen braucht aber diese Person jetzt die Unterstützung.
Wenn jeder immer nur positiv, gut, optimistisch redet, dann findet sich [leicht] eine Schar von Menschen, mit der man sich darum umgibt.
Aber es gibt eben einen Kern [an Menschen], der ist nicht nur in guten Zeiten da, der ist vor allem in den Zeiten da, wo andere weglaufen. Und so einen Kern sollte jeder Mensch haben – und das ist manchmal nicht mehr als eine Handvoll.
Aber was ist das Schöne daran? Dass dir das eben eine Stabilität gibt. Weil du weißt, egal was da kommt: Ich hab‘ einen Job, ich hab‘ keinen – die sind da. Ich habe eine Freundin, ich habe keine Freundin – die sind da.«
Meister Shi Heng Yi sagt also, daß der wichtige Begriff der Loyalität kein „Schönwetterstandard“ ist, sondern einer, dessen Wert sich gerade erst dann ermißt, wenn er in Konflikten miteinander Stand hält – und (trotzdem) erwiesen wird.
Und „Loyalität“, welche schon als Grundwert der Oligoamory in Eintrag 3 aufgeführt wird, verfügt auf der deutschsprachigen Wikipedia über die folgende großartige Definition »die auf gemeinsamen moralischen Maximen basierende oder von einem Vernunftinteresse geleitete innere Verbundenheit und deren Ausdruck im Verhalten gegenüber einer Person, Gruppe oder Gemeinschaft. Loyalität bedeutet, im Interesse eines gemeinsamen höheren Zieles, die Werte des Anderen zu teilen und zu vertreten bzw. diese auch dann zu vertreten, wenn man sie nicht vollumfänglich teilt, solange dies der Bewahrung des gemeinsam vertretenen höheren Zieles dient. Loyalität zeigt sich sowohl im Verhalten gegenüber demjenigen, dem man loyal verbunden ist, als auch Dritten gegenüber.«
Hier ist beides enthalten: Die romantische, freiwille Selbstbeschränkung („…diese auch dann zu vertreten, wenn man sie nicht vollumfänglich teilt…“) und die Verantwortung für das größere Ganze, welches es zu erhalten und zu fördern gilt („ der Bewahrung des gemeinsam vertretenen höheren Zieles…“), die von unserem Wunsch und unserer freien Wahl der „inneren Verbundenheit“ umwunden sind.
Unterm Strich ist nämlich auch die zunächst mit etwas Stirnrunzen betrachtete „(Abhängigkeits)Symbiose“ keine Schönwetterveranstaltung. Denn erst einmal verbunden, schwingt doch auch hier die Tür von Wohl und Wehe von allen Beteiligten in jedwede Richtung.
„Siehste, und deswegen, würde ich so eine Symbiose von Anfang an vermeiden…!“
Ja? Das wäre genau die falsche Lehre aus dem zuvor Gesagtem gezogen. Denn exakt die Symbiose ermöglicht es, Mißstände oder Mißtöne aufgrund der verbundenen Ressourcen ganz anders aufzufangen, als es uns als bloßes Individuum je gelingen könnte.
Eine Fußballmannschaft wird heutzutage normalerweise in einer Weise zusammengestellt, in der sich Talente möglichst zu Höchstleistungen ergänzen sollen.
Doch schon vor Jahrhunderten im Mittelalter – einer Zeit, in der sich die Menschen ihrer Unvollkommenheiten und Abhängigkeiten vermutlich noch wesentlich elementarer bewußt waren als wir heute – entstand die Doppelgestalt „des Blinden und des Lahmen“, der in der Neuzeit die deutsche Folk-Rock-Band „Ougenweide“ auf ihrem Album „All die weil ich mag“ (1974) mit der Vertonung eines Textes von Christian Fürchtegott Gellert¹ noch einmal ein akkustisches Denkmal gesetzt hat: In dem Lied treffen ein lahmer Krüppel und ein Blinder aufeinander, nach kurzer Verhandlung trägt der Blinde den Lahmen, der im Gegenzug dem Blinden den richtigen Weg weist. Das Lied kulminiert mit den Zeilen:
Vereint wirkt also dieses Paar
Was einzeln keinem möglich war.
Du hast das nicht, was andre haben
Und andern mangeln deine Gaben.
Aus dieser Unvollkommenheit
Entspringet die Geselligkeit.
Wenn jenem nicht die Gabe fehlte,
Die die Natur für mich erwählte,
So würd‘ er nur für sich allein
Und nicht für mich bekümmert sein
Beschwer‘ die Götter nicht mit Klagen!
Der Vorteil, den sie dir versagen
Und jenem schenken, wird gemein:
Wir dürfen nur gesellig sein!
„Geselligkeit“, wie sie die Mittelalterlichen (und auch noch Herr Gellert im 18. Jahrhundert) sie einst nannte , hat heute einen leicht anderen Namen: Wir sagen mittlerweile „Gemeinschaft“. „Abhängigkeitssymbiose?“ Vielleicht darum auch eher ein Wort, was lieber der Vergangenheit angehören sollte. Wir könnten „Solidarität“ dazu sagen. Oder in einer romatischen Beziehung aus mehreren Beteilgten schlicht: Liebe.
¹ Der deutsche Dichter und Moralphilosoph Christian Fürchtegott Gellert sah sich selbst übrigens in Kontinuität mit den Ideen des von mir verehrten englischen Philosophen, Schriftsteller, Politiker, Kunstkritiker und Literaturtheoretiker Anthony Ashley Cooper, den ich in Eintrag 64 zu Wort kommen lasse.
Danke an Mary Taylor auf Pexels für das Foto!